Dienststellung (Drittes Reich)
Allgemeines
In der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) war das damalige Deutsche Rote Kreuz (1937–1945/46) in die militaristischen Strukturen des NS-Staats (1933–1945) integriert worden, sehr sichtbar durch die Neuorganisaton in Landesstellen, die eng an die Wehrkreise angelehnt waren. Ebenso wurden die Dienststellungen (Dienstränge, Ränge, Dienstgrade) so gewählt, dass sie mit denen der Wehrmacht, der Unterorganisationen der NSDAP und der ihr verbundenen Organisationen vergleichbar waren.
Die Dienststellung ist von der Verwendung in der Organisation zu unterscheiden. Zum Beispiel war Willy Liebel (1897–1945) von 1938 bis 1945 der Landesführer der Landesstelle XIII mit Sitz in Nürnberg, und für diese Aufgabe war er in den Rang eines Generalhauptführers versetzt worden. Oder beispielsweise der Beauftragte des DRK in Frankreich von 1940 bis 1942, Eduard Busse (1898–1962), der für diese Aufgabe in Paris tätig war, hatte die Dienststellung eines Generalführers.
Dienststellungsabzeichen
Als Dienststellungsabzeichen wurden von den Männern Schulterstücke verwendet, von den Frauen weiße oder graue Kragenspiegel. Führer trugen einen Führerdolch statt eines Hauers bzw. Seitengeräts. Weiterhin unterschieden sich auch die Gürtel: Die der Mannschaften hatten ein rechteckiges Kastenschloss, die der Führer ein rundes Führerschloss. Es gab weitere Differenzierungen bei der Bekleidung, zum Beispiel bei der Kopfbedeckung, das heißt bei den Mützen. Einheitlich getragen wurden das Gebietsdreieck, der Kragenspiegel mit einem Roten Kreuz zur Kennzeichnung der Organisationszugehörigkeit und bei Bedarf die Rotkreuz-Armbinde.
Für einige wenige Funktionen wurden unabhängig von der Dienststellung besondere Elemente an der Dienstbekleidung ergänzt. Beispielsweise gab es die Adjutantenfangschnur und für Musiker das Schwalbennest.
Übersicht der Dienststellungen
Mannschaften
| Dienstrang | Abkürzung | Schulterstück (Männer) | Kragenspiegel (Frauen) |
|---|---|---|---|
| Anwärter/in | Aw/Awn |  |
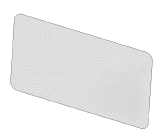
|
| Helfer/in | H/Hn | ||
| Vorhelfer/in | VH/VHn |  |
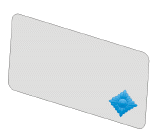
|
| Vorhelfer/in mit Gruppenführerprüfung |

| ||
| Oberhelfer/in | OH/OHn |  |
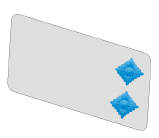
|
| Haupthelfer/in | HH/HHn |  |
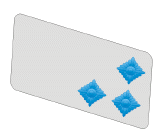
|
| Haupthelfer mit Zugführerprüfung |

|
Führungskräfte
| Dienstrang | Abkürzung | Schulterstück (Männer) | Kragenspiegel (Frauen)1 |
|---|---|---|---|
| Wachtführer/in | WF/WFn |  |
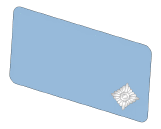
|
| Oberwachtführer/in | OWF/OWFn |  |
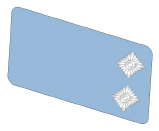
|
| Hauptführer/in | HF/HFn |  |
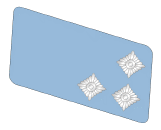
|
| Feldführer/in | FF/FFn |  |
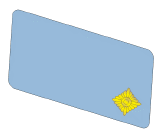
|
| Oberfeldführer/in | OFF/OFFn |  |
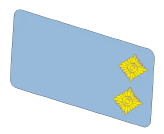
|
| Oberstführer/in | OF/OFn |  |
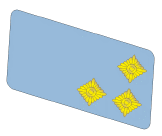
|
| Generalführer/in | GF/GFn |  |
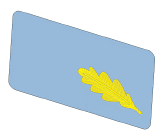
|
| Generalhauptführer/in | GHF/GHFn |  |
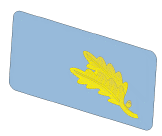
|
Abkürzungen
Für die Bezeichnung einer jeden Dienststellung war eine Abkürzung festgelegt worden, die nur intern zu verwenden war: Sie setzte sich aus dem Vorsatz DRK-… und bis zu drei Buchstaben, die sich aus der Bezeichnung ableiten, zusammen: DRK-Aw (Anwärter), DRK-H (Helfer), DRK-VH (Vorhelfer), DRK-OH (Oberhelfer), DRK-HH (Haupthelfer), DRK-WF (Wachtführer), DRK-OWF (Oberwachtführer), DRK-HF (Hauptführer), DRK-FF (Feldführer), DRK-OFF (Oberfeldführer), DRK-OF (Oberstführer), DRK-GF (Generalführer), DRK-GHF (Generalhauptführer).2
Frauen konnten dieselben Dienststellungen wie Männer führen, und dabei wurden die Bezeichnungen in weiblicher Form geführt. Bei den Abkürzungen wurde bei Frauen ein kleines N (n) angehängt, so dass zum Beispiel eine DRK-Generalhauptführerin mit DRK-GHFn abgekürzt wurde.
Schwesternschaften
Die Rotkreuzschwestern behielten weitgehend ihre Dienststellungen. Jede Schwesternschaft hatte weiterhin ihre Oberin, und zusätzlich gab es kriegsbedingt die Feldoberinnen. Zusätzlich zu den voll ausgebildeten, beruflich qualifizierten Schwestern gab es die Schwesternhelferinnen (SchHn bzw. DRK-SchwHn).
Weitere Informationen
Websites
- Wikipedia.org, Comparative ranks of Nazi Germany (Englisch)
- Wikipedia.org, Ranks and insignia of the German Red Cross (Englisch)
- UniformInsignia.net, German Red Cross - DRK (1935-1945) (Englisch, Frauen]
Enzyklopädie
- Artikel Landesführer und Kreisführer
- Artikel Feldoberin
- Artikel Dienststellungsabzeichen
Einzelnachweise
- ↑ Der hier gezeigte hellblaue Untergrund kann falsch sein, und eventuell waren die Abzeichen tatsächlich grau hinterlegt.
- ↑ Anordnung des Personalamts betreffend Dienstgrad-Abkürzungen vom 25. April 1939: Nachstehend werden die für die DRK-Dienstgrade vorgesehenen Abkürzungen bekanntgegeben. Die Abkürzungen sind nur im inneren Dienstverkehr anzuwenden. — Deutsches Rotes Kreuz, Verordnungsblatt, Berlin 1937ff; Folge 5, Mai 1939, Kennzeichen II (Personalamt), Blatt 5.
